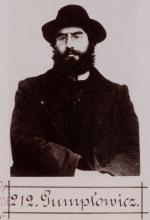Władysław Gumplowicz (1869–1942)
Persönliche Daten
Familienverhältnisse
Vater: Ludwik Gumplowicz; später auch: Ludwig Gumplowicz (Krakau, Freie Republik Krakau [Kraków, Polen] 8. März 1838 – Graz, Steiermark 19. August 1909, Freitod): Hochschullehrer, Staatswissenschaftler, Soziologe, Pionier der Soziologie in Österreich; Heirat 1863 mit:
Mutter: »Fany« Franciszka Gumplowicz, geborene Goldman (Tarnow, Galizien und Lodomerien [Tarnów, Polen] 27. Februar 1845 – Graz, Steiermark 19. August 1909, Freitod): Hausfrau
Bruder: Maksymilian Ernest Gumplowicz: später auch: Max Gumplowicz, Maximilian Gumplowicz (Krakau, Galizien und Lodomerien [Kraków, Polen] 21. Dezember 1864 – Wien 28. November 1897, Freitod): Universitätslektor, Historiker, Publizist
Bruder: Alfred Gumplowicz (Wien 19. Mai 1866 – Graz, Steiermark um 1880)
erste Ehe: in Krakau (Galizien und Lodomerien [Kraków, Polen]) am 9. Jänner 1903 mit Cecylia Cyrla Golde; Pseudonym: Cecylia (Płock / Плоцк, Königreich Polen, de facto Russland [Płock, Polen] 1868 – Warschau ‹Warszawa›, Polen 5. August 1930): Journalistin, sozialdemokratische Aktivistin
zweite Ehe: in Warschau ‹Warszawa› (Polen) 1937 mit Wanda Wołk (10. Februar 1890 – Warschau ‹Warszawa›, Polen 27. Juli 1975): Pädagogin, sozialdemokratische Aktivistin
Kinder: keine
Biographie
Der Sozialdemokrat Władysław Gumplowicz in Graz
Ignacy Władysław Gumplowicz – er führte 1875 bis 1910 den Namen »Ladislaus Ignatz Gumplowicz« – wurde am 15. Februar 1869 als jüngstes Kind von Franciszka Gumplowicz (1845–1909) und Ludwik Gumplowicz (1838–1909), später ein Pionier der Soziologie und Nestor der Soziologie in Österreich, in Krakau (Galizien und Lodomerien [Kraków, Polen]) geboren. 1875 übersiedelte Władysław Gumplowicz mit seinen Eltern nach Graz (Steiermark). Schon als Gymnasiast an Literatur interessiert, betätigte er sich als Übersetzer aus dem Polnischen und übertrug unter anderem Gedichte von Adam Asnyk (1838–1897) und die »Sonety krymskie« (Krim-Sonette) von Adam Mickiewicz (1798–1855), letztere im Auftrag des »Musikvereins für Steiermark« in Graz. Nach der Reifeprüfung studierte Władysław Gumplowicz Medizin an der Universität Graz, wo er 1891 zum Dr. med. promoviert wurde. Nach Abschluss des Praktikums an der psychiatrischen Klinik des Allgemeinen Krankenhauses Graz als Assistenzarzt ließ er sich 1892 kurzzeitig als Kinderarzt in Graz, Neubaugasse 12, nieder. Im Herbst desselben Jahres trat er der »Sozialdemokratischen Arbeiterpartei« bei, wurde Mitglied des »Allgemeinen Arbeiter-Fortbildungs-, Rechtsschutz- und Unterstützungs-Vereins für Steiermark« und betätigte sich vorübergehend als Redakteur des steirischen Parteiorgans »Arbeiterwille. Organ des arbeitenden Volkes der Alpenländer« (Graz).1 Als Mitglied des »Politischen Vereins ›Wahrheit‹« wandte er sich in mehreren öffentlichen Reden gegen die Unabhängigen Socialisten in Graz. Am 31. März 1893 wurde Gumplowicz anlässlich einer Rede bei einer sozialdemokratischen Versammlung vom Bezirksgericht Graz wegen Ehrenbeleidigung zu 30 Gulden Geldstrafe verurteilt.
Der Anarchist Władysław Gumplowicz
Bereits im April 1893 brach Władysław Gumplowicz nach ideologischen Differenzen mit der Sozialdemokratie, verließ Graz und ging zunächst in die Schweiz. Hier inskribierte er für das Sommersemester an der Medizinischen Fakultät der Universität Zürich / Zurich / Zurigo (Kanton Zürich, Schweiz). Im August 1893 nahm er am Internationalen Sozialistischen Kongress in Zürich als Delegierter teil. Nachdem auf diesem Kongress die sozialdemokratische Mehrheit den Ausschluss der anarchistischen Minderheit durchgesetzt hatte, kam es zur endgültigen Trennung der anarchistischen Opposition der »Jungen« von der deutschen Sozialdemokratie. Die Anarchisten veranstalteten daraufhin einen eigenen Kongress in Zürich. Hier trat der spätere polnische Nationalist Władysław Gumplowicz noch als überzeugter Internationalist auf: »die nationale Freiheit Polens hat nie etwas anderes bedeutet, als die Freiheit der Junker die Bauern zu schinden. Heute würden sich einige jüdische und deutsche Grossbourgeois mit den Junkern in die Freiheit des Schindens teilen und die Arbeiter mit den Bauern in die Freiheit des Geschundenwerdens«.2 Den Bruch Gumplowiczs mit der Sozialdemokratie zeigt auch ein Bericht über seine Rede auf dem Anarchisten-Kongress: »Dr. Gumplowicz betonte, wie sehr die Sozialdemokratie den revolutionären Standpunkt verloren habe, zeige ihr grosser Glaube an den Wert des Parlamentarismus. Es gebe sogar sozialdemokratische Polizeidirektoren.«3 Und schon damals zeigte sich seine Sympathie für das so genannte Lumpenproletariat mit durchaus sozialrevolutionärer Romantik als Hauptmotivation: »Dr. Gumplowicz sagte, die Maifeiern lassen noch vielfach zu wünschen übrig. In Zürich gleiche die Feier vielfach dem Sechseläutenfest. Der Proletarier solle bleich, verzehrt, zerlumpt sich zeigen, wie er auch lebe.«4
In Zürich lernte Władysław Gumplowicz auch den wortführenden deutschen Anarchisten, Philosophen und Literaturwissenschaftler Gustav Landauer (1870–1919) kennen, dem er – nach einem vorübergehenden Aufenthalt in Graz – im Oktober 1893 nach Berlin (Preußen [Berlin]) folgte. Nach der Verhaftung des bisherigen Herausgebers Gustav Landauer übernahm Gumplowicz im Oktober 1893 die Redaktion der anarchistischen Zeitung »Der Sozialist« (Berlin). Bei einer Arbeitslosenversammlung meinte Gumplowicz am 22. Jänner 1894, dass der Staat »der Büttel der der Arbeiterclasse« sei: »Seid Ihr bis zu Euerem 70. Jahre noch nicht todtgehungert und todtgeschunden, bekommt Ihr eine Rente. Der Staat ist eine gesetzlich geschützte Räuberbande.«5 Als ihn der anwesende Polizeileutnant verhaften wollte, entstand ein Tumult und Gumplowicz selbst leistete heftigen Widerstand. Am 16. Februar 1894 wurde er vom Landgericht I Berlin wegen Vergehens gegen die öffentliche Ordnung und des Widerstandes gegen die Staatsgewalt zu eineinhalb Jahren Gefängnis verurteilt, obwohl der Staatsanwalt »nur« ein Jahr gefordert hatte. Am 21. Mai 1894 erhielt er wegen derselben Rede wegen Aufreizung zur Gewalt und zum Diebstahl vom Landesgericht I Berlin eine Zusatzstrafe von neun Monaten. Der engagierte Mitarbeiter diverser Zeitungen und Zeitschriften und Redner auf zahlreichen Volksversammlungen konnte aber die Achtung seiner anarchistischen Mitstreiter nur in geringem Ausmaß erringen, bot er doch zu offensichtlich das Bild der damals gerade aufkommenden Bohemien-Anarchisten. Kennzeichnend ist die Schilderung eines Berliner Genossen: »In Kleidung und Haltung war er bemüht, das echte Bild eines elenden Proletariers zu geben. Aber weit entfernt, damit Zutrauen und Anerkennung zu wecken, reizte er nur die Lachmuskeln der Arbeiter. Selbst diejenigen, deren Genosse er sich nannte, machten sich über seine Pose lustig. Ich erinnere mich, wie, als er auf einer kleinen Arbeiterfestlichkeit mit viel echtem Feuer eine revolutionäre Freiligrathsche Dichtung vortrug, die ernste Stimmung der Zuhörer sich, aller begeisterten Rhetorik zum Hohn, in laute Heiterkeit auflöste, als um den Leib des hastig Gestikulierenden der einfach geknotete grobe Strick sichtbar wurde, der bestimmt war, die Hosenträger zu ersetzen.«6
Am 9. Juli 1896 aus dem Strafgefängnis Plötzensee in Berlin entlassen, wurde Władysław Gumplowicz, damals regelmäßiger Mitarbeiter der Zeitung »Die Zeit« (Wien), am 11. Juli 1896 aus Preußen ausgewiesen. Nach einem kurzen Aufenthalt in Graz zog er nach Brüssel ‹Ville de Bruxelles / Stad Brussel› (Belgien). Unter dem Einfluss des Geografen Élisée Reclus (1830–1905), der an der Université libre de Bruxelles als Professor lehrte, wurde Gumplowicz Dozent an dieser Hochschule. In Brüssel befreundete er sich auch mit dem Wiener Journalisten und Schriftsteller Stefan Grossmann (1875–1935), der eine Zeit lang bei ihm wohnte. Damals ging Gumplowicz auch eine Lebensgemeinschaft mit der deutschen Philosophiestudentin und späteren volkswirtschaftlichen Publizistin Fanny Imle (1878–1965) ein. Sie war eine engagierte Anarchistin, während sich Gumplowicz in gerade diesen Jahren vom Anarchismus zunehmend abwandte.7 Mit dem Weggang Gumplowiczs aus Brüssel endete auch diese Lebensgemeinschaft.
Der polnisch-nationalistische Sozialdemokrat Władysław Gumplowicz
1898 wurde Władysław Gumplowicz aus Belgien ausgewiesen, ging zunächst nach London (England), wo er dem 1898 dem 1892 in Paris (Frankreich) gegründeten »Związek Zagraniczny Socjalistów Polskich« (Auslandsbund Polnischer Sozialisten) und im Dezember 1898 dem Londoner »Socialdemokratischen Club« beitrat. Bald danach ließ er sich in Zürich als Arzt und Schriftsteller nieder. Im Sommersemester 1900 inskribierte er neuerlich an der Medizinischen Fakultät der Universität Zürich, setzte aber seine Studien nicht weiter fort. In den Züricher Jahren näherte sich Gumplowicz wieder der Sozialdemokratie an. Im Oktober 1899 nahm er am Kongress der deutschen Sozialdemokratie in Hannover (Preußen [Niedersachsen]) teil. Außerdem war Gumplowicz ein überaus eifriger politischer Journalist, der seit 1893 an unzähligen Zeitungen und Zeitschriften mitarbeitete: »Arbeiterwille« (Graz), »Deutsche Worte« (Wien), »Neue deutsche Rundschau« (Berlin), »Rheinisch-westfälische Arbeiterzeitung« (Dortmund), »La Riforma sociale« (Torino), »Der Sozialist« (Berlin), »Sozialistische Monatshefte« (Berlin), »Wilshire’s Magazine« (Los Angeles, California), »Die Zeit« (Wien), »Die Zukunft« (Berlin) und viele andere mehr.
In der Schweiz erwachte auch Gumplowiczs Interesse für den polnischen Nationalismus, weshalb er wiederholt in seine Geburtsstadt Krakau reiste. In Zürich arbeitete er an der polnischen Gesellschaft »Zgoda« (Eintracht) mit und trat der 1893 geschaffenen »Polska Partia Socjalistyczna« (Polnische Sozialistische Partei) bei. Als deren Funktionär wirkte er im November 1899 auch an der Einverleibung des »Związek Zagraniczny Socjalistów Polskich« in die »Polska Partia Socjalistyczna« mit. Außerdem war er Kontaktmann der »Polska Partia Socjalistyczna« zur 1897 geschaffenen »Polska Partia Socjalno-Demokratyczna w Galicji i Śląska Cieszyńskiego« (Sozialdemokratische Partei Galiziens und des Teschener Schlesiens), an deren Programm von 1900 er mitarbeitete. Seine durchaus eigenständigen, mit der »Polska Partia Socjalistyczna« und »Polska Partia Socjalno-Demokratyczna w Galicji i Śląska Cieszyńskiego« nicht immer konformen Ansichten legte er in diversen Zeitungsartikeln da. So arbeitete er an den Zeitungen »Przedświt« (Kraków; Morgenröte), »Prawo Ludu« (Kraków; Volksrecht) und »Naprzód« (Kraków; Vorwärts) mit. Am 10. August 1901 hielt er übrigens seinen letzten Vortrag in Graz: »Über die gewerkschaftliche Entwicklung in Deutschland«.8 Im September 1901 nahm Gumplowicz an der Konferenz polnischer Sozialisten in Lübeck (Freie und Hansestadt Lübeck [Hansestadt Lübeck, Schleswig-Holstein]) teil, wo sich Sozialisten der »Polska Partia Socjalistyczna« aus London (England) und Berlin sowie der »Polska Partia Socjalno-Demokratyczna w Galicji i Śląska Cieszyńskiego« aus Krakau trafen. Im Anschluss daran wurde er Korrespondent der Zeitung »Naprzód« (Kraków) und arbeitete auch am Parteiorgan der »Polska Partia Socjalistyczna«, »Gazeta Robotnicza« (Berlin, seit 1901 Katowice; Arbeiterzeitung), mit.
Nach kurzen Aufenthalten in Wien und London übersiedelte Władysław Gumplowicz im September 1902 nach Krakau, wo er Mitredakteur der Zeitungen »Gazeta Robotnicza« (Katowice) und »Naprzód« (Kraków) wurde. Außerdem fungierte er als Redakteur und seit 1902 als verantwortlicher Schriftleiter der »Przedświt« (Kraków), Organ der »Polska Partia Socjalistyczna«. Daneben arbeitete er – teilweise unter den Pseudonymen »Piotr Górkowski« und »Władysław Krakowski« – an diversen Zeitungen und Zeitschriften mit: »Latarnia« (Kraków; Die Laterne), »Krytyka« (Kraków; Die Kritik), »Światło« (Kraków; Das Licht). In Krakau heiratete Władysław Gumplowicz im Jänner 1903 die Genossin Cecylia Golde (1868–1930), mit welcher er bereits seit 1902 eine Lebensgemeinschaft führte und mit der er seither politisch eng zusammengearbeitet hatte. Auf dem 9. Parteitag der »Polska Partia Socjalistyczna« im November 1906 kam es zu einer Spaltung der Partei in eine linksorientierte Mehrheit, die »Polska Partia Socjalistyczna – Lewica« (Polnische Sozialistische Partei – Linke), und in eine rechts tendierende Minderheit, die »Polska Partia Socjalistyczna – Frakcja Rewolucyjna« (Polnische Sozialistische Partei – Revolutionäre Fraktion), welche sich seit 1909 wieder einfach »Polska Partia Socjalistyczna« nannte. Gumplowicz schloss sich der Revolutionären Fraktion an, für die er 1908 ein Agrarprogramm entwickelte und in deren Organ »Robotnik« (Warszawa; Der Arbeiter) er publizierte. Im Mai 1907 kandidierte er für diese Fraktion bei den ersten allgemeinen Wahlen (allerdings noch ohne Frauenwahlrecht) zum österreichischen Reichsrat für den Kreis Biała-Stadt. Aus dieser Zeit stammen auch Gumplowiczs gute Kontakte zum Führer der Revolutionären Fraktion, dem Militär und späteren polnischen Staatschef Józef Klemens Piłsudski (1867–1935).
Daneben betrieb Władysław Gumplowicz intensive Forschungen zur Wirtschaftsgeografie und unternahm vor allem zwischen 1907 und 1909 ausgedehnte Studienreisen nach Paris, London, Bern / Berne / Berna (Kanton Bern, Schweiz) und Wien. Am 24. November 1911 promovierte er an der Universität Wien zum Dr. phil. (Geografie) mit der Arbeit »Ueber den Einfluß der geographischen Bedingungen auf die Entwicklung der australischen Kolonien«.
Nach dem Freitod seiner Eltern regelte Władysław Gumplowicz deren Verlassenschaft in Graz und kehrte dann nach Krakau zurück. Er engagierte sich in den folgenden Jahren vor allem auf dem Gebiet der Bildung, insbesondere der Volksbildung. Seit Herbst 1910 war er als Lehrer an der sozialistischen Parteischule tätig, war Mitglied der Bildungskommission der »Polska Partia Socjalno-Demokratyczna w Galicji i Śląska Cieszyńskiego« und investierte sein von den Eltern geerbtes Vermögen vor allem in ein »Domy ludowe« (Volkshaus) und in den Verlag »Książka« (Kraków; Das Buch).
Im Februar 1914 reiste Władysław Gumplowicz nach Paris, wo er sich wiederholt mit Józef Klemens Piłsudski traf. Nach dem Beginn des Ersten Weltkriegs übersiedelte Gumplowicz im August 1914 wieder in die Schweiz. Er hielt regelmäßig Vorträge für die polnische Sache in Genf / Genêve / Ginevra (Kanton Genf, Schweiz), Lausanne / Losanna (Kanton Waadt, Schweiz) und Zürich, publizierte unter anderen unter dem Pseudonym »Peregrinus Vistulensis« und schrieb auch für das für die Staatswerdung Polens wichtige »Naczelny Komitet Narodowy« (Nationales Volkskomitee).
Nach Kriegsende kehrte Władysław Gumplowicz nach Krakau zurück, wirkte zunächst wieder als Arzt und setzte sich als Parteifunktionär für eine Volksbefragung in Górny Śląsk (Oberschlesien) ein. 1919 weilte er als Vertreter des polnischen Außenministeriums in der Botschaft in Wien.
1923 übersiedelte Władysław Gumplowicz nach Warschau und begann erst im außerordentlich späten Alter von 54 Jahren eine Universitätskarriere. Er habilitierte sich 1923 für Anthropologie an der Wolnej Wszechnica Polskie (Freie Polnische Universität) in Warschau, wurde hier im Dezember 1924 zum außerordentlichen Professor für Wirtschaftsgeografie und Anthropologie und 1937 ad personam zum ordentlichen Professor für Wirtschaftsgeografie ernannt. Daneben lehrte er von 1924 bis 1927 als Dozent in den Intendanzkursen der Wyższej Szkoły Wojennej (Militärakademie) in Warschau und von 1928 bis 1934 als Dozent für Wirtschaftsgeografie und Anthropologie an der Universität Łodz (Polen). Überdies gehörte er jahrelang der Prüfungskommission der »Polskie Towarzystwo Geograficzne« (Polnische Geografische Gesellschaft) an.
Besonders bemühte sich Władysław Gumplowicz um die Volksbildung und hielt regelmäßig Vorträge für den 1923 in Warschau gegründeten »Towarzystwo Uniwersytetu Robotniczego« (Verein Arbeiterhochschule) und bei deren Sommerkursen in Zakopane (Polen). Meist unter den Kryptonymen »Dr. W. G.«, »Gu.«, »L. G.«, »-ski«, »w. g.«, »W. G.«, »W.Gu.« und »-wicz« veröffentlichte er populärwissenschaftliche Artikel in den Zeitschriften »Robotnik« (Warszawa; Der Arbeiter) und »Dziennik Popularny« (Warszawa; Das Volksblatt).
Außerdem war Władysław Gumplowicz weiterhin für die »Polska Partia Socjalistyczna« tätig, welche im April 1920 alle vor der Unabhängigkeit Polens in den Teilungsgebieten tätigen »Polska Partia Socjalistyczna«-Organisationen zu einer Landespartei einen konnte. Für den 23. Kongress der »Polska Partia Socjalistyczna« im Februar 1934 verfasste er ein landwirtschaftliches Grundsatzprogramm, in welchem er unter anderem die entschädigungslose Enteignung der Großgrundbesitzer und die Landaufteilung an mittellose Landarbeiter forderte.
Nach dem Tod seiner ersten Ehefrau Cecylia Gumplowicz 1930 heiratete Władysław Gumplowicz 1937 die Parteigenossin Wanda Wołk (1890–1975).
Nach dem Einmarsch der deutschen Truppen in Warschau am 1. Oktober 1939 nahm Władysław Gumplowicz in führender Rolle am Aufbau der Untergrunduniversität teil. In seiner Wohnung in der Ulica Barska 5 lehrte er Geografie. Zugleich engagierte er sich bei der Untergrundarbeit gegen die Besatzer und hatte Verbindung mit der Gruppe um den Naturwissenschaftler Zygmunt Szymanowski (1873–1956). Unter anderem hielt Gumplowicz in der Lokalorganisation des Stadtteils Ochota Vorträge zur aktuellen politischen Lage. Damals begann er auch zu dichten, einfache, meist satirische Verse, die großteils mündlich verbreitet wurden. Daneben schrieb er auf Aufforderung der Begründerin der Sozialpädagogik in Polen Helena Radlińska (1879–1954) Artikel für die Untergrundpresse. Am 10. September 1942 starb Władysław Gumplowicz an Erschöpfung und wurde am evangelisch-reformierten Friedhof in Warschau beigesetzt.
Publikationen
Bücher und Broschüren
Ehe und freie Liebe. Von Ladislaus Gumplowicz. (Umschlag-Zeichnung von Käthe Kollwitz.) Berlin: Verlag der Socialistischen Monatshefte (M. Mundt) 1900, 59 S. Erschien unter dem Autorennamen »Ladislaus Gumplowicz«.
b) Ehe und freie Liebe. Von Ladislaus Gumplowicz. (2. Auflage.) Berlin: Verlag der Socialistischen Monatshefte (M. Mundt) 1902, 59 S.
c) Ehe und freie Liebe. Von Ladislaus Gumplowicz. (3. Auflage.) Berlin: Verlag der Socialistischen Monatshefte (M. Mundt) 1902, 59 S.
d) Ehe und freie Liebe. Von Ladislaus Gumplowicz. (4. Auflage.) Berlin: Verlag der Socialistischen Monatshefte (M. Mundt) 1902, 59 S.
A) Huwelijk en vrije liefde. In verband met de ontwikkeling der maatschappij naar het socialisme. Vertaling uit het Duitsch door B. Reyndorp. Amsterdam: J. J. Bos [1901], X, 35 S. Übersetzer: Bernard Reyndorp (1870–1950). Niederländisch: Ehe und freie Liebe. Im Zusammenhang mit der Entwicklung der Gesellschaft zum Sozialismus. Übersetzt aus dem Deutschen von B. Reyndorp.
B) Manželstvi a volná láska. Přeložil J. Picek. Královské Vinohrady: nákladem »Studentského sborníku« [1904], 28 S. Erschien unter dem Autorennamen »Ladislaw Gumplowics«. Übersetzer: Josef Picek (1883–1934). Tschechisch: Ehe und freie Liebe. Übersetzt von J. Picek.
C) Брак и свободная любовь. Пер. с 4-го нем. изд. П. Николаева. Лейпциг [Leipzig] – Санкт-Петербург [Sankt Petersburg]: »Мысль«, А. Миллер 1906, 23 S. Erschien unter dem Autorennamen »Владислав Гумплович«. Übersetzer: Pjotr Fjodorowitsch Nikolajew ‹Петр Федорович Николаев› (1844–1910). Russisch: Ehe und freie Liebe. Nach der 4. deutschen Ausgabe übersetzt von P. Nikolaev.
Cb) Брак и свободная любовь. Пер. с 4-го нем. изд. П. Николаева. Лейпциг [Leipzig] – Санкт-Петербург [Sankt Petersburg]: »Мысль«, А. Миллер 1906, 23 S. 2. Auflage.
Cc) Брак и свободная любовь. Пер. с нем. 3-е изд. Москва [Moskau]: Тип. т-во И. Д. Сытина 1907, 47 S. 3. Auflage.
D) Брак и свободная любовь. Олный перевод со 2-го немецкого издания М. Анина. Одесса [Odessa]: Книгоиздательство »Демос« 1906 (= Экономическая библиотека. 18.), 32 S. Erschien unter dem Autorennamen »Владислав Гумплович«. Übersetzer: Maxim Anin ‹Максим Анин›, d. i. Max Schatz-Anin ‹Макс Шац-Анин› (1885–1975). Ukrainisch: Ehe und freie Liebe. Vollständige Übersetzung nach der 2. Ausgabe von M. Anin.
E) Avioliitto ja vapaa rakkaus. Alkukielen neljännestä painoksesta suomensi Erl. Aarnio. Pori: Osuuskunta Kehitys 1907, 33 S. Übersetzer: Erland Aarnio (1881–1938). Finnisch: Ehe und freie Liebe. Erste Ausgabe nach der vierten Ausgabe übersetzt von Erl. AarnioNationalismus und Internationalismus im 19. Jahrhundert von Ladislaus Gumplowicz. Berlin: Aufklärung [1902] (= Am Anfang des Jahrhunderts. 7.), 56 S.
- Ferdynand Lassalle (w 40-tą rocznicę śmierci). Karta z historyi socyalizmu w Niemczech. Kraków: Nakładem »Prawa Ludu« [1904] (= Latarnia. 5.), 44 S. Betrifft Ferdinand Lassalle (1825–1864). Polnisch: Ferdinand Lassalle (zum 40. Todestag). Mit einer Karte zur Geschichte des Sozialismus in Deutschland.
A) Фердинанд Лассаль. Страничка из истории социализма в Германии. Пер. c полск. А. Котика. Санкт-Петербург [Sankt Petersburg]: »Луч« 1906, 38 S. Erschien unter dem Autorennamen »Владислав Гумплович«. Übersetzer: A. Kotik ‹А. Котик›. Russisch: Ferdinand Lassalle. Eine Seite aus der Geschichte des Sozialismus in Deutschland. Übersetzt aus dem Polnischen von A. Kotik - Międzynarodowe braterstwo proletaryatu. Kraków: Nakładem »Prawa Ludu« [1904] (= Latarnia. R. 4. 3.), 36 S. Polnisch: Die internationale Bruderschaft des Proletariats.
- Norwegja. Warszawa: skład główny w Księgarnia Naukowa 1907 (= Bibljoteka Spółczesna.), 103 S. Erschien unter dem Autorennamen »Władysław Krakowski«. Polnisch: Norwegen.
- Nowa Zelandja (podług angielskich źródeł). Warszawa: skład główny w Księgarnia Naukowa 1904 (= Bibljoteka Spółczesna.), 57 S. Erschien unter dem Autorennamen »Władysław Krakowski«. Polnisch: Neuseeland (nach englischen Quellen).
Przyczynek do kwestji rolnej w Królestwie Polskim. Warszawa: Druk. Wł. Teodorowicza 1908 (= Nakładem Wydawnictwa dzieł społeczno-politycznych »Życie«. 13.), 119 S. Erschien unter dem Autorennamen »Piotr Górkowski«. Polnisch: Ein Beitrag zur Agrarfrage im Königreich Polen.
Kwestya polska a socyalizm. Warszawa: Odbito Drukarni literackiej 1908 (= Nakładem Wydawnictwa dzieł społeczno-politycznych »Życie«.), 115 S. Polnisch: Die polnische Frage und der Sozialismus.
Dzieje zalozenia Stanów Zjednoczonych pólnocnej Ameryki. Z 3 mapkami. Kraków: Spółka nakładowa »Książka« [1909], VI, 142 S. Polnisch: Gründungsgeschichte der Vereinigten Staaten von Nordamerika. Mit 3 Karten.
Ueber den Einfluß der geographischen Bedingungen auf die Entwicklung der australischen Kolonien. Wien 1911, Maschinschrift. Philosophische Dissertation an der Universität Wien. Verfasst unter dem Autorennamen »Wladyslav Gumplowicz«
Russia and Poland during the present war by Peregrinus Vistulensis. Lausanne: Imprimerie Paul Delacombaz 1915, 20 S. Erschien unter dem Autorennamen »Peregrinus Vistulensis«. Englisch: Russland und Polen während des gegenwärtigen Krieges.
Obłąkani królowie. Szkice z dziejów państw monarchicznych. Warszawa: Księgarnia Robotnicza 1923, 119 S. Polnisch: Königliche Wahnsinnige. Skizzne über historische monarchische Herren.
- Geografja ekonomiczna. Warszawa: Wyższa Szkoła Intendentury 1926, 332 S. Polnisch: Wirtschaftsgeografie.
Australja i Oceanja. Kraków: Nakł. Księgarni Geograficznej »Orbis« 1927 (= Bibljoteczka Geograficzna »Orbis«. Ser. II. Geografja Regjonalna.), 220 S. Polnisch: Australien und Ozeanien.
Geografja gospodarcza. Warszawa: Księgarnia F. Hoesicka 1927, VII, 212 S. Polnisch: Wirtschaftsgeografie.
b) Geografja gospodarcza. Wyd. 2 przerobione. Warszawa: Księgarnia F. Hoesicka, 1938, 317 S. Polnisch: Wirtschaftsgeografie. 2. überarbeitete Auflage.- Rozwój gospodarstwa światowego. Warszawa: Drukazania Techniczna Sp. Akc. [1928] (= Biblioteka Samokształcenia. 2.), 96 S. Polnisch: Entwicklung der Weltwirtschaft.
Australja i Oceanja, napisał Dr. Władysław Gumplowicz. Warszawa: Trzaska, Evert i Michalski. [1937] (= Wielka Geografja Powszechna.), 179 S. Polnisch: Australien und Ozeanien, verfasst von Dr. Władysław Gumplowicz.
- Japonja. Warszawa: Trzaska, Evart i Michalski [1937] (= Wielka geografia powszechna. Tom 12. 2.), 115 S. Erschien unter dem Autorennamen »Władysław Nowakowski«. Polnisch: Japan.
- Azja Południowa. Warszawa: Trzaska, Evert i Michalski, [1938] (= Wielka Geografja Powszechna.), VI, 363 S. Polnisch: Südasien.
Herausgeber
- Lieder und Gedichte für das arbeitende Volk. Lodz [Łódź]: Polnische Sozialistische Partei 1907, 158 S. Zusammengestellt von Władysław Gumplowicz.
Übersetzer
Adam Asynk (1838–1897): Adam Asnyks ausgewählte Gedichte. Deutsch von Ladislaus Gumplowicz. Wien: Verlag von Carl Konegen 1887, 135 S.
- Adam Asynk (1838–1897): Von der Weltbühne. Aus dem Polnischen des Adam Asnyk von Dr. Ladislaus Gumplowicz. Separat-Abdruck aus »Die Waffen nieder.« Dresden – Leipzig – Wien: E. Pierson’s Verlag 1895, unpaginiert (8 S.). Übersetzung von sieben Sonetten aus: Die Waffen nieder! Monatsschrift zur Förderung der Friedensbewegung (Berlin), 4. Jg. Nr. 6 (Juni 1895), S. 215–218.
Eduard David (1863–1930): Dwie rozprawki o stosunku socyalizmu do rolnictwa. Spolszczył Władysław Gumplowicz. Lwów: Polskie Towarzystwo Nakładowe 1904, 126 S. Erschien unter dem Autorennamen »Edward David«. Original: Socialismus und Landwirtschaft. 1. Die Betriebsfrage. Berlin 1903. Polnisch: Zwei Abhandlungen über das Verhältnis Sozialismus und Landwirtschaft. Ins Polnische übersetzt von Władysław Gumplowicz.
- Pjotr Alexejewitsch Kropotkin ‹Пётр Алексеевич Кропоткин› (1842–1921): Die historische Rolle des Staates. Aus dem Französischen übersetzt von Dr. Ladislaus Gumplowicz. Separat-Abdruck aus dem »Sozialist«. Berlin: Verlag von Adolf Grunau 1898, 56 S. Erschien unter dem Autorennamen »Peter Kropotkin«. Enthält auch D[er] Herausgeber [d. i. Gustav Landauer (1870–1919)]: Vorbemerkung, S. 3–6. Original: Original: L’État, son rôle historique, in: Le Temps Nouveaux (Paris) vom 19. Dezember 1896 bis 3. Juli 1897, als Broschüre Paris 1906.
b) Die historische Rolle des Staates. Aus dem Französischen übersetzt von Ladislaus Gumplowicz. Titelzeichnung von Gustav Wolff. Berlin: Verlag »Der Syndikalist« (Fritz Kater) 1920, 48 S. Erschien unter dem Autorennamen »Peter Kropotkin«.
c) Die historische Rolle des Staates. Aus dem Französischen übersetzt von Ladislaus Gumplowicz. Titelzeichnung von Gustav Wolff. Berlin: Verlag »Der Syndikalist« (Fritz Kater) [1923], 31 S. Erschien unter dem Autorennamen »Peter Kropotkin«. - Peter Sandiford (1882–1941): Szkolnictwo angielskie. Przełożył Władysław Gumplowicz. Uzupełnił Jan Hellmann. Warszawa: »Nasza Księgarnia« 1927 (= Biblioteka Dzieł Pedagogicznych. Rok 2. 6.), 193 S. Beiträger: Jan Hellmann (1883–1932). Original: The training of teachers in England and Wales. New York City, N. Y. 1910. Polnisch: Das englische Schulwesen. Übersetzung von Władysław Gumplowicz. Ergänzt von Jan Hellmann.
Kategorien
Adresse(n)
- Krakau, Galizien und Lodomerienn [Kraków, Polen], Krakau 423 (Geburtsadresse)
- Graz, Steiermark, Neubaugasse 12 (Wohnadresse 1892)
- Warschau ‹Warszawa›, Polen, Ulica Barska 5 (Wohnadresse 1939 bis 1942)
Karte
Autor / Version / Copyleft
Autor: Reinhard Müller
Version: Jänner 2026
Anarchistische Bibliothek | Archiv | Institut für Anarchismusforschung | Wien
Copyleft
- 1
Władysław Gumplowicz war auch Mitarbeiter der Gelegenheitsschrift: Nichts von Goethe und Schiller. Aus Proletarier-Mussestunden. Herausgegeben von J. Resel. Graz: Verlag der Redaction des »Arbeiterwille« [1893], 23 S.
- 2
Władysław Gumplowicz, zitiert nach Max Nettlau (1865–1944): Die erste Blütezeit der Anarchie: 1886-1894. Vaduz: Topos Verlag 1981 (= Max Nettlau: Geschichte der Anarchie. Herausgegeben in Zusammenarbeit mit dem Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, Amsterdam. 4.), S. 447.
- 3
J[ohann] Langhard (1855–1928): Die anarchistische Bewegung in der Schweiz von ihren Anfängen bis zur Gegenwart und die internationalen Führer. Berlin: Verlag von O. Häring 1903, S. 323.
- 4
J[ohann] Langhard (1855–1928): Die anarchistische Bewegung in der Schweiz von ihren Anfängen bis zur Gegenwart und die internationalen Führer. Berlin: Verlag von O. Häring 1903, S. 324.
- 5
Władysław Gumplowicz, zitiert nach [anonym): Ein verurtheilter Socialist, in: Agramer Zeitung (Agram), 69. Jg., Nr. 39 (17. Februar 1894), S. 2.
- 6
Albert Weidner (1871–1946): Aus den Tiefen der Berliner Arbeiterbewegung. Berlin – Leipzig: H. Seemann Nachf. [1905] (= Grossstadt-Dokumente. 9.), S. 23.
- 7
Vgl. den Bericht der Generaldirektion der öffentlichen Sicherheit, Brüssel, am 13. Dezember 1898, im Steiermärkischen Landesarchiv, Graz, Statth. Präs. 8-2626/1898.
- 8
Vgl. den Polizeibericht, Graz, am 19. August 1901, im Steiermärkischen Landesarchiv, Graz, Statth. Präs. 8-42/1901.